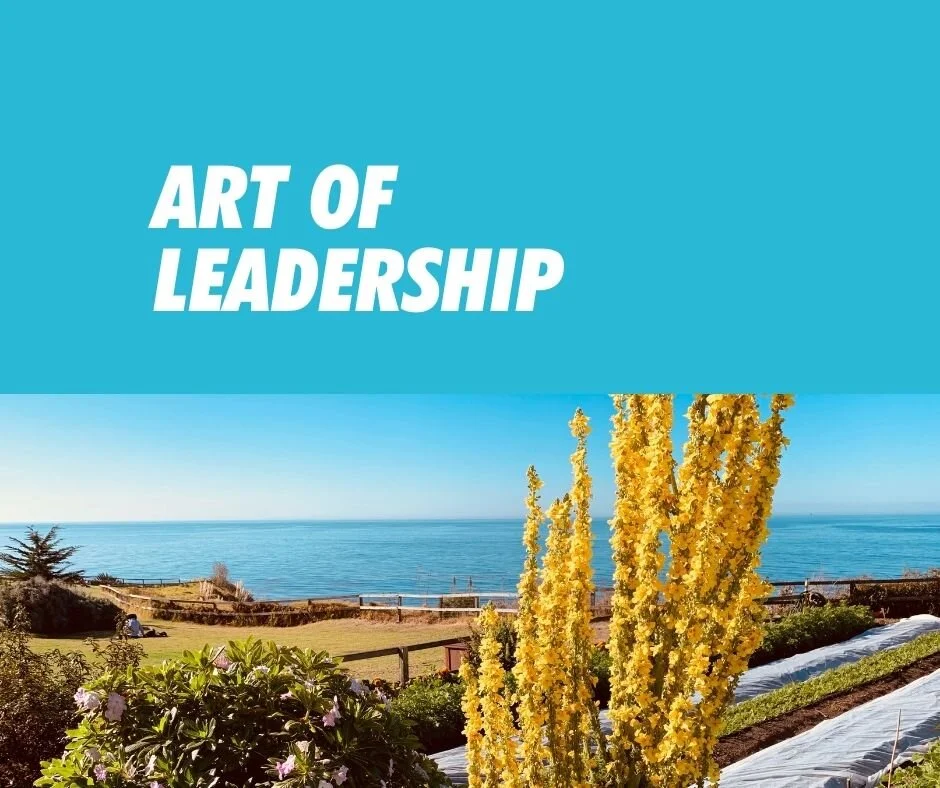AI as the Biggest Bet in History: What It Means for Your Business
Der “Altweibersommer” gibt sich noch einmal ein Stelldichein, die Schüler kommen wieder zurück in die Schulen und die Regierung in Österreich möchte mit “Programmen” wieder die Konkunktur entfachen. Gleichzeitig ist man ziemlcih erfolglos, wenn man das Wort Künstliche Intelligenz in den Medien sucht - niemand scheint sich für die größte Transformation in der Menschheitsgeschichte zu interessieren. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil gerade jetzt in nur wenigen Tagen über 319 Milliarden Dollar in Künstliche Intelligenz Investitionen geflossen sind, ein unfassbarer Geldregen.
Laut The Economist werden bis 2028 weltweit unfassbare 3 Billionen USD in Rechenzentren fließen, um das Trainieren der KI Modelle zu ermöglichen. Alle rittern um die Vorherrschaft dieser Rechenzentren, die die Basis für das Trainieren der Modelle ist.
Die Frage ist, was bedeutet dies für Unternehmen hier in Europa? Steht eine große Blase bevor oder riskieren wir, wenn wir nicht investieren, den Zug zu verpassen? Darum geht es in diesem Beitrag und auf was Unternehmen nun aufpassen müssen.
KÜNSTLICHE iNTELLIGENZ Gigantonomie
Oracle schloss gerade einen 300-Milliarden-Dollar-Deal mit OpenAI ab und steigerte damit seine Marktkapitalisierung an nur einem Tag um 100 Milliarden Dollar. Nebius unterzeichnete ein 17,4-Milliarden-Dollar-Abkommen mit Microsoft, das europäische KI Unternehmen Mistral sammelte 1,7 Milliarden Dollar ein, das erst vor 2 Jahren gegründetet Unternehmen Perplexity fügte 200 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 20 Milliarden hinzu.
Alle diese Transaktionen haben eine Botschaft: die Rechenleistung ist der Garant für die KI Pole Postiion. Es ist sind nicht die Schaufler - KI Modelle - die zählen, sondern es ist die Schaufel - die Rechenleistung - um die es geht, wenn man den Vergleich aus der Goldgäberzeit verwendet.
Diese aktuellen Transaktionen und Bewertungen sind völlig irrational, das wissen auch die Investoren - aber es ist nichts anderes als eine Wette - eine Wette auf den nächsten KI Big Player - denn es gilt noch immer die Regel, the winner takes it all.
The winner takes ist all: Apple hat das I Phone erfunden und hat seinen Platz noch immer in der Pole Position, das gleiche war im Suchbereich mit Google und im Betriebsystem mit Micorsoft, daher auch gerade das hektische Treiben.
Denn es gibt noch die eine Karotte, die heisst Super AGI, eine Intelligenz die uns Menschen überholt. Niemand weiss, wann diese gefunden wird, es könnte nächstes Jahr oder in 10 Jahren sein, aber niemand zweifelt daran, dass sie kommen wird. Und niemand möchte diesen Zug verpassen, der unser Leben, so wie wir es kennen, gundlegend verändern wird.
Doch wenn über längere Zeit Kapitalzuflüsse die Fundamentaldaten überholen, zeigt die Geschichte, dass ein Crash unvermeidlich ist.
DROHT bald ein crash?
Heute glauben Investoren, dass die wahrscheinlichen KI-Gewinner diejenigen sind, die die größten Modelle betreiben können. Aber so sicher scheint dies auch nicht zu sein, denn immer mehr Unternehmen brauchen nur kleinere Sprachmodelle und daher auch weniger Rechenleistungen.
Dadruch könnte die KI Verbreitung langsamer und holpriger verlaufen, als Investoren erwarten. Kinderkrankheiten in der Technologie, die Schwierigkeit, schnell genügend Strom zu liefern, oder auch behäbige Unternehmensführung könnten bedeuten, dass die Einführung von Künstlicher Intelligenz langsamer erfolgt als erhofft. Wenn Investoren ihre Erwartungen an KI-Erlöse nach unten korrigieren, könnten viele von ihnen und ihre Gläubiger weniger bereit sein, riesige Investitionen zu finanzieren. Der Kapitalfluss könnte versiegen; einige Startups, die unter der Last von Verlusten leiden, könnten ganz zusammenbrechen.
Zuerst ist der Funke
In ihrem Buch Boom and Bust unterscheiden die Wirtschaftshistoriker William Quinn und John Turner zwischen politischen und technologischen Funken. Blasen, die durch Politiker entfacht werden – etwa durch neue Steuergesetze oder Regulierungen – richten mehr Schaden an als solche, die durch neue Technologien entstehen. Politische Funken treiben Investoren zu Herdenverhalten.
Niedrige Grundsteuern, niedrige Zinsen und Finanzliberalisierung führten in Japan in den späten 1980ern zu einer gigantischen Vermögensblase. Jahrzehntelang nach deren Platzen blieb Japans Wirtschaft träge. Technologische Funken dagegen richten weniger Schaden an: Auf die Dotcom-Manie folgte keine lange Rezession.
Im Gegensatz dazu können Blasen der Gesellschaft nutzen, wenn sie dauerhafte Vermögenswerte schaffen. Die Eisenbahn-Manie baute das Rückgrat des britischen Schienennetzes, auch wenn Profitabilität lange auf sich warten ließ. Die zig Millionen Meilen Glasfaserkabel, die in den späten 1990ern in den USA verlegt wurden, waren weit mehr, als das Internet damals brauchte – doch sie ermöglichen heute datenintensive Dienste wie Streaming und Videotelefonie.
Blasen sind normal
Das mag wie ein bemerkenswertes Eingeständnis wirken, doch viele Akteure argumentieren zugleich, dass Blasen bei neuen Technologien normal seien.
„Technologische Begeisterung läuft der technologischen Realität immer voraus“, so Michael Parekh, ein ehemaliger Analyst von Goldman Sachs. „Die Geschichte zeigt, dass Phasen großer technologischer Innovation oft von spekulativen Blasen begleitet werden, weil Investoren auf echte Produktivitätsfortschritte überreagieren“, heißt es in einer 2008 von der Federal Reserve Bank of San Francisco veröffentlichten Studie.
Eine akademische Untersuchung aus dem Jahr 2018, die 51 Innovationen zwischen 1825 und 2000 untersuchte, fand heraus, dass 37 von ihnen mit Blasen einhergingen.
Die meisten Blasen verhinderten nicht, dass sich die Technologien weltweit durchsetzten. In Großbritannien gab es zwei große Eisenbahnblasen, in den 1840er und 1860er Jahren – und dennoch verfügt das Land heute über ein dichtes Bahnnetz. Amerikanische Investoren gerieten in den 1880er Jahren bei Elektrizitätsgesellschaften in Ekstase und verloren viel Geld, doch bis heute wollen Amerikaner nachts Licht haben. KI könnte demselben Muster folgen und es scheint eines der Naturgesetze des Lebens zu sein.
Gibt es neue Gewinner?
Und doch hätte ein Crash gewaltige Folgen, denn eine historische Lektion lautet: Wenn Tech-Blasen platzen, treten oft neue Herausforderer an die Stelle der etablierten Firmen. „Die größten und erfolgreichsten Beleuchtungsfirmen erlebten alle einen Kontrollwechsel, sobald der Cashflow zum Problem wurde“, schrieb Alasdair Nairn in Engines That Move Markets, das sich mit dem späten 19. Jahrhundert befasst. Viele Unternehmen, die die Frühzeit von Eisenbahn, Telegraph und Telefon dominierten, wurden ebenfalls rasch verdrängt. Wer erinnert sich heute noch an Vulcatron aus der amerikanischen Elektronikblase der 1960er Jahre oder an Corning, einst ein klingender Name im Dotcom-Boom? Es wäre daher ein großes Wunder, wenn in einem Jahrzehnt noch alle „glorreichen Sieben“ börsennotierten Tech-Konzerne und die größten KI-Startups existieren.
Was bedeudet dies für Unternehmer in Österreich
Vieles am aktuellen KI-Hype sieht nach einer Blase aus, die auch zu Korrekturen führen wird, da bin ich mir sicher. Aber was wir nicht machen dürfen, ist nun einfach zu warten bis der Sturm vorbei ist. Denn zu weitreichend und transormativ sind die die Technologien, zu langsam und teuer sind noch unsere Prozesse, zu viele Mitarbeiter bruachen wir, die wir nicht haben - schlichtweg, es gibt soviele Probleme, die es zu lösen gilt und KI wird uns dabei helfen.
In vielen mittelständische Industrieunternehmen gibt es die Sorge, dass die Rezession weiter anhaltet, dass wir in Europa in einer Strukturkrise sind und die Probleme noch größer werden. Und es gibt diese leise Vermutung, dass Künstliche Intelligenz einige dieser Probleme lösen wird können, aber viele wissen noch nicht wie. Viele haben Angst den ersten Schritt zu gehen, aufs falsche Pferd zu setzen, mit Start-ups kooperieren, die vielleicht mal scheitern werden. Vieles davon mag berechtigt sein, aber das was man nicht darf, ist die Hände in den Schoß zu legen, denn es gibt einige Low hanging fruits:) , die vor allem Industrieunternehmen viel Geld sparen könnten, wie die folgenden Beispiele zeigen:
Predictive Maintenance: KI erkennt frühzeitig Verschleiß in Produktionslinien und verhindert so ungeplante Stillstände, die sonst Millionen kosten können.
Qualitätskontrolle: Durch Bild- und Sensordaten werden Fehler in Echtzeit erkannt, Ausschussraten sinken und Nacharbeit reduziert sich deutlich.
Supply Chain & Energie: KI optimiert Bestellmengen, verbessert Liefertreue und senkt gleichzeitig den Energieverbrauch – ein Gewinn für Kosten und Nachhaltigkeit.
All diese Ansätze erleben wir hautnah bei unseren Lernreisen ins Silicon Valley, wenn wir mit Startups, Tech-Pionieren und etablierten Unternehmen sprechen.
Dabei wird deutlich: Die Einführung von KI verändert nicht nur Prozesse, sondern vor allem Führung und Organisation. Entscheidungen müssen schneller getroffen werden, Teams brauchen mehr Eigenverantwortung, und Führungskräfte müssen lernen, Unsicherheit auszuhalten und trotzdem klare Richtung zu geben. Organisationen, die bisher auf Stabilität und Kontrolle gebaut waren, entwickeln sich hin zu Netzwerken, die agiler, experimentierfreudiger und anpassungsfähiger sind.
Vor allem braucht es Mut in das Unbekannte zu gehen, sich selber in Frage zu stellen und nicht überheblich dort zu verharren, was vielleicht schon überholt ist.
Für Führungskräfte im Mittelstand ist das die entscheidende Botschaft: Nicht der größte Wetteinsatz zählt, sondern die Fähigkeit, schnell Erfahrungen zu sammeln, Organisationen auf Veränderung vorzubereiten und daraus Wettbewerbsvorteile zu bauen.
Wer abwartet, überlässt anderen das Feld. Wer mutig handelt, macht aus der KI-Blase einen strategischen Vorsprung – in Technologie, Organisation und Leadership.
Autor: Mag. Werner Sattlegger, CEO und Founder
Hinweis:next Silicon Valley Learning Journey, 08.- 12. Juni, 2026
Literatur
Titel: Two Centuries of Innovations and Stock Market Bubbles
Autoren: Alina Sorescu, Sorin M. Sorescu, Will J. Armstrong & Bart Devoldere
Economist
Studien
„Financial Turmoil and the Economy“, Federal Reserve Bank of San Francisco Annual Report 2008
→ Beschreibt die wirtschaftlichen Auswirkungen der Finanzkrise Anfang 2008. Federal Reserve Bank of San Francisco
„Consumer Sentiment and Consumer Spending“, Economic Letter (28. Juni 2008), FRBSF
→ Untersucht den Zusammenhang von Verbrauchermeinung und Konsumausgaben
Autor: Werner Sattlegger
Founder & CEO Art of Life
Experte für digitale Entwicklungsprozesse, wo er europäische mittelständische Familien- und Industrie-unternehmen von der Komfort- in die Lernzone bringt. Leidenschaftlich gerne verbindet er Menschen und Unternehmen, liebt die Unsicherheit und das Unbekannte, vor allem bewegt ihn die Lust am Gestalten und an Entwicklung.