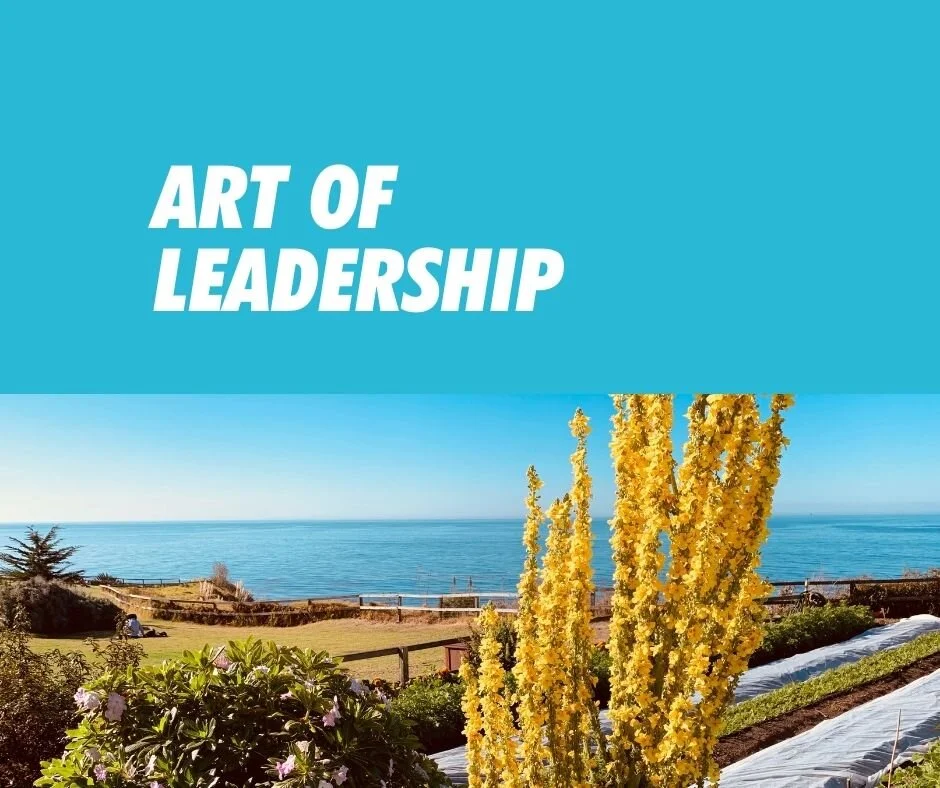Play, don't plan
Golden Gate Park, spätnachmittags – das Licht ist warm, die Farben leuchten tief. Der Geruch von Eukalyptus und Mammutbäumen liegt in der Luft, eine Brise vom Ozean zieht über die Hügel. Ein unglaublich schöner Sonntag an einem geschichtsträchtigen Ort.
Man spürt noch die Vibes der Gegenkultur – dort, wo im angrenzenden Haight-Ashbury die Hippie-Bewegung ihren Anfang nahm und wo das legendäre Human-Be-In am 17. Jänner 1967 den Startschuss für den Summer of Love gab.
Ich stehe mitten im Hardly Strictly Bluegrass Festival, dem größten kostenlosen Konzert der Welt: über 70 Bands an drei Tagen, rund eine halbe Million Besucher. Keine Tickets, keine Werbung, keine VIP-Bereiche. Nur Sonne, Staub, Gitarren, Stimmen.
Nur wenige Straßen entfernt begann in den 60ern die Gegenkultur – eine Explosion aus Musik, Widerspruch und Freiheit. Heute nennen wir es Innovation. Damals nannten sie es einfach Leben. Nur ein paar Kilometer weiter, im Silicon Valley, spüre ich denselben Geist – nur in anderer Verpackung. Teams bauen in Wochen, was andere in Jahren planen. Bestehendes wird radikal in Frage getellt und verworfen, Risiken werden eingegangen und das Unbekannte betreten - dort wo Innovation stattfindet.
ABWARTEN UND ABSICHERN
Während im Silicon Valley gebaut, getestet und verbessert wird, zählt in Österreich noch immer das Planen, Prüfen, Absichern. Wir sind Meister der Kontrolle – aber keine Meister der Erneuerung. Und das spürt man in den Unternehmen. In der österreichischen Industrie sind wir bekannt für Präzision, Verlässlichkeit und Planung. Darin sind wir stark – doch genau das ist auch unsere Schwäche.
Wo wir nicht gut sind, ist Innovation.
Spricht man mit Führungskräften aus der Industrie, spürt man gerade jetzt selten Begeisterung. Stattdessen hört man von hohen Energie- und Personalkosten, von bürokratischen Regulierungen und davon, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind.
Das zeigt sich nicht nur in den aktuellen Kündigungswellen und schwachen Wirtschaftsdaten, sondern auch in den Rückmeldungen über typische Unternehmenskulturen:
Silo-Denken: Bereiche optimieren sich selbst, statt gemeinsam Neues zu wagen.
Langsame Entscheidungen: Wir diskutieren, während andere schon testen.
Angst vor Fehlern: Wer scheitert, verliert Ansehen statt Erkenntnis.
Politisches Taktieren: Energie fließt in Machtspiele statt in Mut.
Komfortzonen-Kultur: Sicherheit ist wichtiger als Schöpfung.
Learning form disorder
Hier im Valley erlebe ich super hungrige und motivierte Menschen, die auch bereits sind Risiken einzugehen und im Unbekannten zu tanzen. Junge Ingenieure, die keine Angst vor Fehlern haben. Gründer, die zehnmal scheitern und beim elften Mal treffen. In Europa dagegen: Bürokratie, Risikoaversion, Überregulierung.
Wir reden von Innovation, führen aber wie in einem Maschinenraum – alles kontrolliert, alles abgesichert.
Doch das eigentliche Problem liegt tiefer. Es geht nicht nur um Kosten, Bürokratie oder Struktur – es geht um unseren Umgang mit Risiko. Wir behandeln Risiko wie etwas, das man vermeiden muss, statt wie etwas, das man gestalten kann. In unseren Unternehmen herrscht oft die Logik der Robustheit: Wir wollen stabil bleiben, Störungen aushalten, Krisen überstehen. Aber Stabilität ist trügerisch.
Der Denker und ehemalige Trader Nassim Nicholas Taleb hat dafür ein besseres Konzept geschaffen – Antifragilität.
Taleb sagt: Es gibt drei Arten von Systemen.
Fragil: Dinge, die unter Druck zerbrechen – wie Glas.
Robust: Dinge, die Druck aushalten – wie Stahl.
Antifragil: Dinge, die durch Druck stärker werden – wie Muskeln.
Während Europa versucht, robust zu sein, ist das Silicon Valley antifragil. Hier sind Störungen kein Risiko, sondern Brennstoff.
- Fehler sind Daten.
- Krisen sind Wachstumsschübe.
- Jede Erschütterung wird genutzt, um das System zu verbessern – schneller, klüger, anpassungsfähiger zu werden.
Taleb nennt das die Barbell-Strategie: 80 % Sicherheit, 20 % Risiko – das schützt vor dem Absturz, hält aber die Lernzone offen. Denn Systeme, die nie Stress erleben, verlernen zu reagieren. Und Organisationen, die nie Fehler machen, verlernen zu lernen.
Europa hingegen glaubt noch immer, dass man Unsicherheit planen kann. Doch das Gegenteil ist wahr:
Je komplexer die Welt wird, desto mehr brauchen wir Strukturen, die vom Unvorhersehbaren profitieren.
Antifragilität bedeutet:
Nicht Risiken vermeiden, sondern Bedingungen schaffen, in denen man durch sie wächst.
Nicht Kontrolle erhöhen, sondern Lernzyklen verkürzen.
Nicht Angst vor Chaos haben, sondern den Rhythmus darin finden.
Was können Führungkräfte nun ganz konkret tun?
1. Micro-Ownership statt Kontrolle
Führung heißt, Verantwortung zu verteilen, nicht zu sammeln.
Teams auf max. 10 Personen begrenzen.
Jedes Team bekommt eigene Ziele, Kennzahlen, Mini-Budgets.
Entscheidungen werden dort getroffen, wo Wissen entsteht.
Ergebnis: Geschwindigkeit, Fokus, Vertrauen.
2. Prototyping as Routine
Nicht planen – testen.
Jährliches Experimentierbudget (z. B. 50.000 €) schaffen.
Ideen in 8 Wochen real ausprobieren.
Ergebnisse öffentlich machen – egal ob Erfolg oder Scheitern.
Ergebnis: Innovation wird zum Muskel, nicht zum Zufall.
3. 30-Tage-Regel
Jede neue Idee braucht eine Entscheidung – in höchstens 30 Tagen.
Führung verpflichtet sich auf klare Ja/Nein/Pilot-Entscheidungen.
Entscheidungen dokumentieren, nicht vertagen.
Ergebnis: Energie bleibt hoch, Politik verschwindet.
4. Stress-Tests statt Forecasts
Krisen trainieren, bevor sie passieren.
Quartalsweise Szenarien simulieren: „Was, wenn Umsatz –30 %?“
Gegenmaßnahmen im Team entwickeln. Ergebnis: Organisationen reagieren adaptiv statt panisch.
5. Shadow Startups
Innovation im Konzern braucht eigene Räume.
Was tun:
Kleine Teams mit eigenem Mini-P&L ausstatten.
Klare Deadlines, klare Lernziele.
Ergebnis: Unternehmergeist statt Prozessdenken.6. Failure Fridays
Einmal im Monat spricht jeder über einen Misserfolg – die Führung zuerst.
Fokus: Was habe ich gelernt?
Ergebnis: Vertrauen wächst, Angst sinkt.
7. Skin in the Game
Führung ohne Risiko ist Verwaltung.
Führungskräfte am Ergebnis ihrer Projekte beteiligen.
Bonus für Wirkung, nicht Berichtswesen.
Ergebnis: Entscheidungen werden ehrlicher.
8. Devils Chair
In jedem Meeting sitzt einer, dessen Job es ist, alles zu hinterfragen.
Warum: Ohne Reibung kein Fortschritt.
Ergebnis: Ideen werden klarer, Teams wacher.
Ausblick
Vielleicht ist es kein Zufall, dass ausgerechnet San Francisco die Bühne für all das ist – eine Stadt zwischen Ozean und Abgrund, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Während Europa noch darüber diskutiert, wie man Risiken verwaltet, lernen die Musiker, Gründer und Ingenieure hier, mit ihnen zu tanzen. Sie haben verstanden, dass man die Zukunft nicht prognostiziert –
man erspielt sie.
Antifragilität bedeutet nicht, jede Krise zu überleben. Es bedeutet, durch sie lebendiger zu werden. Nicht Widerstand, sondern Wandlungsfähigkeit. Die wahre Kunst der Führung besteht heute darin, Strukturen zu schaffen, die Unordnung aushalten – und daraus lernen. Organisationen, die Fehler öffentlich machen.
Die nächste Dekade wird denen gehören,
die Risiko in Rhythmus verwandeln – und Angst in Bewegung.
Play. Don’t Plan. Der Rest folgt von selbst.
Hinweis:next Silicon Valley Learning Journey, 08.- 12. Juni, 2026
Literatur
Nicolas Nassim Taleb: “Skin in the game”
Titel: Two Centuries of Innovations and Stock Market Bubbles
Autoren: Alina Sorescu, Sorin M. Sorescu, Will J. Armstrong & Bart Devoldere
Economist
Studien
„Financial Turmoil and the Economy“, Federal Reserve Bank of San Francisco Annual Report 2008
→ Beschreibt die wirtschaftlichen Auswirkungen der Finanzkrise Anfang 2008. Federal Reserve Bank of San Francisco
„Consumer Sentiment and Consumer Spending“, Economic Letter (28. Juni 2008), FRBSF
→ Untersucht den Zusammenhang von Verbrauchermeinung und Konsumausgaben
Autor: Werner Sattlegger
Founder & CEO Art of Life
Experte für digitale Entwicklungsprozesse, wo er europäische mittelständische Familien- und Industrie-unternehmen von der Komfort- in die Lernzone bringt. Leidenschaftlich gerne verbindet er Menschen und Unternehmen, liebt die Unsicherheit und das Unbekannte, vor allem bewegt ihn die Lust am Gestalten und an Entwicklung.